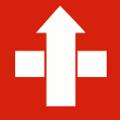Die neuen Leiden des Herrn Urner
Beim Kennenlern-Gespräch wurde Edgar Urner* von drei Kitteln nach seinem Befinden gefragt. Urners Blick hastete vom einen zum anderen. Schliesslich fauchte Urner die drei an: "Ich sage gar nichts, bevor ich nicht weiss, ob einer von Ihnen Muslim ist!". Er lehnte sich zurück und verschränkte abwehrend und ein wenig triumphierend die Arme. Die drei gegenüber warfen einander ratlose Blicke zu. "Nicht… das ich wüsste…", entgegnete der Mittlere unsicher. Die beiden anderen verneinten ebenfalls. Ausgezeichnet, sagte Urner, dann könne man ja Klartext reden und endlich mit diesem Wischiwaschi aufhören. Man müsse das Problem bei der Wurzel packen. Der Mittlere nickte verständnisvoll und forderte Urner auf, seine Sicht der Dinge darzulegen. "Sie sind überall! Und alles, aber alles nehmen sie uns weg", kreischte Urner. Zuletzt hätten sie uns auch noch die Wurst genommen, und deshalb müsse man handeln, jetzt oder nie, brüllte Urner seine Gesprächspartner an. "Interessant, fahren Sie fort.", erwiderte der mittlere Kittel und hakte kurz etwas auf einem Formular ab.
Urner lief nun zu Bestform auf. Sein herrscherischer Blick schweifte über die vor ihm brodelnden Menschenmassen. "Es geht um die Wurst, meine Damen und Herren!", beschwor Urner seine Zuhörer. "Wer uns die Wurst nimmt, will uns an den Kragen! Verstehen Sie?", trumpfte Urner auf und trommelte mit dem Zeigefinger auf den Tisch. Ob er das ein wenig ausführen könne, fragte die linke Frau in Weiss. Die Wurst sei ja nur der Anfang, so Urner, nein, man könne ja keinen Fuss mehr vor die Türe setzen, ohne auf einen Gebetsteppich zu treten. "So sieht's aus, so weit ist es gekommen!" keifte Urner. Er legte eine rhetorische Pause ein. "Hören Sie Stimmen?" fragte der Mittlere. Gewiss, überall und immer, von jedem höheren Gebäude höre er diese Muezzin-Gesänge, bestätigte Urner. "Da hilft es nicht einmal, dass ich im Auto «Im Aargau sind zwöi Liebi» auf voller Lautstärke höre", donnerte Urner. "Wenn wir so weiterfahren", fuhr Urner fort, "enden wir noch alle im Halal". Das sei Arabisch für Hölle, fügte er hinzu, seine Bildung betonend.
Der Kittel auf der rechten Seite fragte Urner, wie diese Hölle denn aussehen würde. Das fühle sich an, als ob man in einem «süttig» heissen Kochtopf voller Poulet-Wienerli schmoren müsse, erklärte Urner leicht ungläubig. "Das haben sie nicht gewusst?" wandte er sich fragend an seine Gesprächspartner. "Wie steht es mit Agressionen, Herr… äh… Urner, genau, Urner?", wollte der mittlere Kittel wissen. Neben der Hölle, genannt Halal, gebe es ja noch den Vorhof zur Hölle, und das sei ein Spiessrutenlaufen durch all diese linken Gutmenschen, führte Urner aus. "Das ist doch die Wurst, äh… Wurzel allen Übels! Die wollen uns Spankferkel-Erlebnis-Reisen nach Argentinien verbieten. Sehen sie es nicht? Auch diese Linken sind vollkommen Halal! Dahinter steckt der eigentliche Angriff auf unser christliches Wurstland und Weltwild!", schloss Urner.
Die drei Kittel zogen sich zur Beratung zurück. Nach fünf Minuten kehrten sie zurück und eröffneten Herrn Urner, dass man eine Lösung gefunden habe. Der Chef-Kittel sagte: "Wir werden Sie von diesen eklatanten Problemen abschirmen, Herr Urner, bis sich die Lage da draussen zum Besseren gewendet hat. Wir haben die Pflicht, Sie vor dieser Welt zu schützen." Herr Urner bedankte sich und wurde von einer unbekannten Frau verständnisvoll aus dem Zimmer begleitet. Als Herr Urner nach 20 Jahren das Gebäude zum ersten Mal verliess, musste er keinem einzigen Gebetsteppich ausweichen. In der Stadt, er hielt fast nicht für möglich, stiess er auf einen Wurststand und leistete sich eine Kalbsbratwurst. Nachdem er diese genüsslich verzehrt hatte, verstand er, dass nun alles gut war. Und als er dann noch den Gesang einer Jodlergruppe vernahm, gab es für ihn kein Halten mehr. Fast wollte er «Im Aargau sind drü Liebi» singen. Die drei Weisskittel hatten ganze Arbeit geleistet und hier draussen gründlich aufgeräumt, dachte er und gönnte sich eine dieser Lila-Laune-Pillen.
*Name geändert, richtiger Name der Redaktion bekannt.